Abbildung 1: gescannte Oberfläche der 10 verschiedenen
Mooreichenproben
Die im Weiteren beschriebenen
Untersuchungen konnten nicht an allen zur Verfügung stehenden Proben
durchgeführt werden. Es wurden weitestgehend nur die als brauchbar eingestuften
Hölzer untersucht. Bei manchen Untersuchungen, mussten selbst hierbei nochmals
Einschränkungen der Anzahl vorgenommen werden (vor allem bei der
Altersbestimmung).
Vorgenommene Untersuchungen und
Ergebnisse
Beim Rauchen einer Pfeife (bzw. schon beim Stopfen
dieser) kommt es zu einer Reihe von zum Teil dramatischen Änderungen im Holz des
Pfeifenkopfes. Wie stark diese Änderungen ausfallen bestimmen letztendlich die
Brauchbarkeit und die Rauchbarkeit (im Sinne des Geschmacks) eine Pfeife. Es
wurden verschiedene Tests ausgewählt, die diese Veränderungen vor allem während
des Rauchens (aber auch während des Stopfens) beschreiben sollen. Dies beginnt
mit dem Alter des Holzes (und somit des Grades des Abbaus des Holzes) und der
Holzdichte. Die Holzausgleichsfeuchtigkeit, die Wasseraufnahme und das Quellmaß
geben Auskunft über den chemischen Zustand (vor allem die Affinität zu Wasser)
des Holzes (und somit auch über den Grad des Abbaus). Diese höhere
Wasseraffinität ergibt sich v.a. durch den geänderten Kritallisationsgrad der
Zellulose da sich beim Holzabbau ein höherer Anteil an amorphen Bereichen
ausbilden kann die für Wassermoleküle leichter zugänglich sind. Des Weiteren ist
die Quellung/Schwindung entscheiden für die Verwendbarkeit des Holzes, da beim
Stopfen relativ viel Feuchtigkeit aufgenommen werden muss. Die chemische Analyse
gibt Aufschluss über die anorganische Zusammensetzung des Holzes; d.h. welche
Stoffe wurden in welchem Umfang nachträglich eingelagert.
Altersbestimmung mittels
Radiokohlenstoffbestimmung (C14)
Die Altersbestimmung von vier
Proben (Nummer 1 bis 4) wurde an der Universität Wien, Vienna Environmental
Research Accelerator (VERA) von Frau Prof. Wild durchgeführt (siehe Tab. 1). Die
Proben waren zwischen rund 1300 und 5000 Jahren alt.
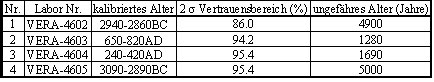
Tabelle 1: Radiokohlenstoffdatierung der vier Proben (BC =
vor Christi Geburt; AD = ano domini)
Der Vergleich der gescannten Oberflächen
(Abb. 1) mit dem Alter (Tab.1) zeigt, dass die Farbgebung nicht mit dem Alter
zusammenhängt, sondern von anderen Faktoren abhängt (Lagerungsbedingungen etc.).
Rauchbarkeit
Die
Rauchbarkeit, d.h. die Brauchbarkeit des Holzes für den Pfeifenbau wurde von
Herrn Prammer – folgend dem Schulnotensystem; 1 = Sehr Gut; bis 5 = Nicht
Genügend – eingestuft (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Rauchbarkeit der verschiedenen Proben
Stellt man die Rauchbarkeit der Farbe
gegenüber, sieht man, dass vor allem die braunen Farbtöne bei den schlechten
Qualitäten überwiegen (siehe Tab. 3).

Tabelle 3: Rauchbarkeit, gereiht nach dem
Schulnotensystem
Bruyère –als Referenz - wird als sehr
gut rauchbar beschrieben.
Holzdichte
Die
Holzdichte ist einer der universellen Holzqualitätsparameter. Sie steht mit sehr
vielen weiteren Parametern in direktem Zusammenhang. Im Fall der Mooreiche ist
sie auch ein Hinweis auf bisher stattgefundene Abbauprozesse.
Die Holzdichte wurde einerseits als
Darrdichte (das ist die Dichte des absolut trockenen Holzes) als auch bei der
Feuchtigkeit, die sich im Normklima (20°C, 65% r.LF) einstellt (rund 12%
Holzfeuchtigkeit) bestimmt.
Die Ergebnisse zeigen eine starke
Schwankung zwischen 0,62 und 0,86 g/cm³ Darrdichte. Wagenführ und Scheiber
(1985) geben Darrdichtewerte von 0,58 bis 0,73 g/cm³ an. Die Probe 7 (Bruyère)
hatte eine Darrdichte von 0,77 g/cm³ (siehe Abb. 2).
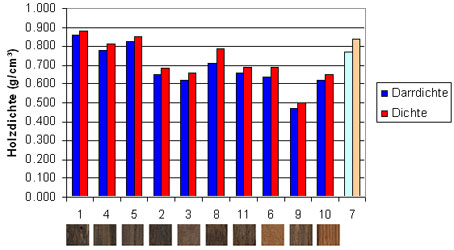
Abbildung 2: Darrdichte (blau) und Rohdichte (bei 12%
Holzfeuchtigkeit; rot) der Proben, sortiert nach der Abnahme der Rauchbarkeit.
Die Probe 7 ist Bruyère.
Auch hier lässt sich ein leichter
Zusammenhang zwischen Rauchbarkeit und Dichte herstellen: Gute Rauchbarkeit
verlangt relativ hohe Dichte (siehe Abbildung 3).
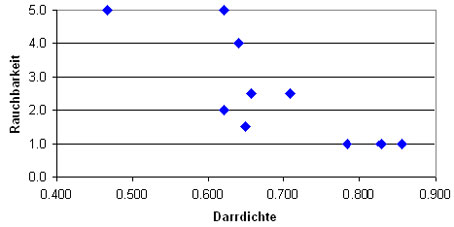
Abbildung 3: Die Abhängigkeit der Rauchbarkeit von der
Holzdichte (ohne Probe 7).
Holzausgleichsfeuchtigkeit
Bei einem bestimmten Klima
stellt sich nach einiger Zeit im Holz eine bestimmte Holzfeuchtigkeit ein. Die
Proben wurden im Normklima (20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit) über mehrere
Wochen gelagert. Bei Fichtenholz stellt sich in diesem Klima eine
Ausgleichsfeuchte von etwa 12% ein. Änderungen können hier vor allem durch einen
veränderten holzchemischen Aufbau hervorgerufen werden. Die Werte schwankten
zwischen 10,6 und 13,5% (siehe Abb. 4). Es kann kein strenger Zusammenhang mit
der Rauchbarkeit hergestellt werden.
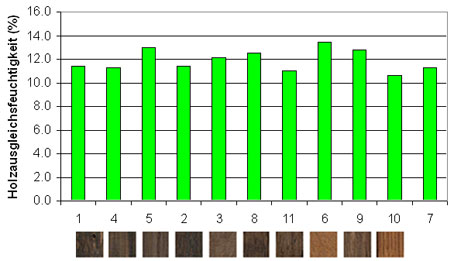
Abbildung 4: Holzausgleichsfeuchtigkeit der Proben (gereiht
nach abnehmender Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)
Das
Quellverhalten
Holz nimmt auf Grund seiner Hygroskopizität auch
Feuchtigkeit aus der Luft (d.h. aus der Luftfeuchtigkeit) auf. Unter dem so
genannten Fasersättigungsbereich (ungefähr 30% Feuchtigkeit; hier sind die
Zellwände mit Feuchtigkeit gesättigt, aber kein flüssiges Wasser in den
Zellhohlräumen) kommt es bei weiterer Trocknung zu Schwind-Erscheinungen. Das
Quellen tritt eben bei Wiederbefeuchtung auf, und ist zahlenmäßig dem Schwindmaß
gleich zu setzten.
Das Ausmaß der Quellung (Schwindung) ist abhängig von der
anatomischen Richtung. In tangentialer Richtung ist es am Höchsten, und zwar
ungefähr doppelt so hoch wie in radialer Richtung. Die Quellmaße verhalten sich
wie folgend: längs:radial:tangential = 1:10:20
In erster Linie wurde das
tangentiale Schwindmaß ausgewählt - hier liegen die höchsten Werte vor. Laut
Wagenführ und Scheiber (1985) liegen diese Werte zwischen 6,9 und 14,2%. Um
Ungenauigkeiten der Präparation ein wenig auszugleichen wurde des Weiteren noch
das Volumsquellmaß errechnet.
Die Werte der tangentialen Quellung
schwankten zwischen 3,8 und 7,4% (siehe Abbildung 5) und sind somit etwas
geringer als in der Literatur beschrieben. Dies dürfte auf die generell sehr
hohe Variabilität als auch auf den Umstand, dass es nicht immer möglich war die
Proben exakt zu präparieren, zurück zu führen sein. Durch die zum Teil nicht
perfekte Orientierung, kommt es zu einer geringen Verschiebung in Richtung
radialem Schwindmaß, und somit zu einer Reduktion der Werte.
Nachdem Bruyère
nicht orientiert wächst, ist ein Vergleich hier nicht möglich.
Es ist ein sehr schwacher Trend zu
höheren Werten bei guter Rauchbarkeit zu erkennen. Das Volumsquellmaß (Abb. 6)
bestätigt den Trend des tangentialen Quellmaßes. Es kann ein schwacher
Zusammenhang mit der Rauchbarkeit erkannt werden: Bessere Rauchbarkeit bei
höheren Quellmaßen.
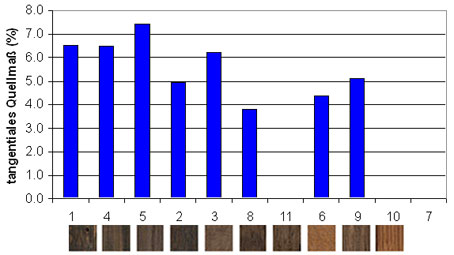
Abbildung 5: Tangentiales Quellmaß der Proben (gereiht nach
abnehmender Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)
Reduzierte Quellung ist zumeist ein
Hinweis auf eine „Modifikation“ des Holzes – wie es zum Beispiel auch beim
Dämpfen des Holzes auftritt. Eine Änderung der chemischen Zusammensetzung – im
Sinne der organischen Hauptbestandteile (Zellulose, Lignin, Hemizellulosen) –
kann auch zur Verringerung der Quellung führen. Bzw. hängt die Quellung stark
mit der Dichte zusammen. D.h. wird die Dichte durch Abbauprozesse reduziert,
wird sich auch die Quellung verringern.
Feuchtigkeitsaufnahme
Die Feuchtigkeitsaufnahme ist
ein wesentliches Kriterium einer guten Pfeife. Während des Rauchens muss der
Holzkörper aus dem Tabak Feuchtigkeit aufnehmen.
Dieses Kriterium wurde
versucht nachzustellen. Darrtrockenen Proben wurden in einem geschlossenen Gefäß
über einer offenen Wasseroberfläche für 20 Minuten gelagert (kein Kontakt der
Proben zum flüssigen Wasser). Die Proben wurden vor und nach der Lagerung
gewogen und die Massenzunahme durch die Wasseraufnahme bestimmt.
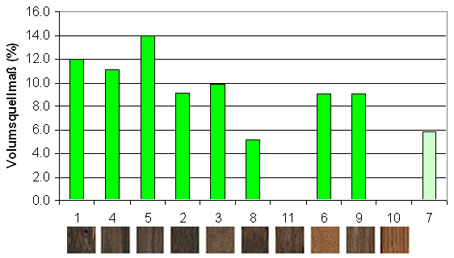
Abbildung 6: Volumsquellmaß der Proben (gereiht nach
abnehmender Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)
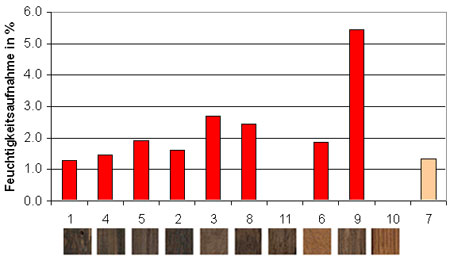
Abbildung 7: Feuchtigkeitsaufnahme der Proben (gereiht nach
der Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)
In Abbildung 8 ist zu erkennen, dass es
einen Zusammenhang zwischen der Wasseraufnahmekapazität (in 20 Minuten) und der
Verwendbarkeit zum Pfeifenbau gibt. Sehr gut rauchbare Hölzer nehmen weniger
Wasser auf, als schlechte Qualitäten. Die Menge an aufgenommenem Wasser in der
sehr guten Rauchbarkeitsklasse entspricht relativ genau der Menge, die Bruyère
aufnehmen kann. Auch dies dürfte in erster Linie ein Hinweis auf die
organisch-chemische Beschaffenheit des Holzes und somit der Zustand des Holzes
(Abbau des Holzes) sein.
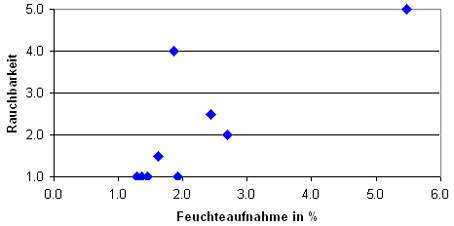
Abbildung 8: Die Abhängigkeit der Rauchbarkeit von der
Wasseraufnahme in 20 Minuten (ohne Probe 7, 10, 11).
Aschegehalt
Bestimmung des Aschegehaltes:
Ein bis
zwei Gramm des vorher getrockneten Probenmaterials wurden in einem Tiegelofen
bei 700°C verascht. Dabei wurden im ersten Teil der Oxidation die Tiegel
zugedeckt um den Austrag von Asche während der intensiven Verbrennung der
Kohlenstoffhältigen Verbindungen zu verhindern. Nach ca. 1 Stunde wurden die
Tiegel abgedeckt, und weitere 3 Stunden im Ofen belassen. Nach dem Abkühlen der
Tiegel wurde der Masseverlust bestimmt (siehe auch Fengel und Wegener 1989). Es
wurden jeweils mindestens zwei Bestimmungen durchgeführt.
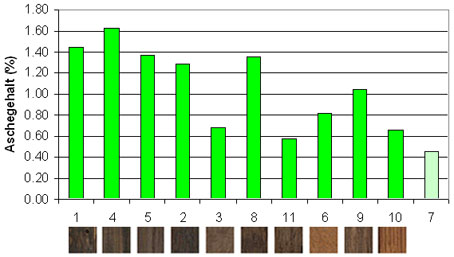
Abbildung 9: Aschegehalt der Proben (gereiht nach
abnehmender Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)
Der Aschegehalt gibt an, wie viele
anorganische Substanzen (weitestgehend Salze) sich im Holz befinden. Wagenführ
und Scheiber (1985) geben ungefähr 0,8% für Mooreiche an. D.h. die gemessenen
Werte (von 0,5 bis 1,6% - siehe Abb. 9) befinden sich ungefähr im zu erwartenden
Bereich.
Die Aschegehaltswerte für frisches Eichenholz liegen bei rund 0,2%
(Wagenführ und Scheiber 1985). Bei der Mooreiche sind die Werte vor allem durch
die Einlagerung von Salzen durch die Lagerung selbst erhöht.
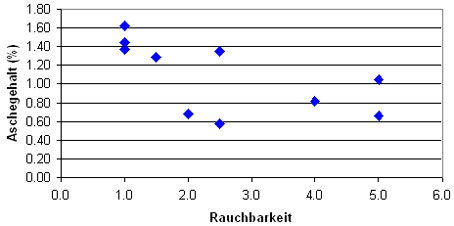
Abbildung 10: Die Abhängigkeit der Rauchbarkeit vom
Aschegehalt (ohne Probe 7).
In den Abbildungen 9 und 10 ist zu
erkennen, dass die Rauchbarkeit mit dem Aschegehalt zusammenhängt: Gute
Rauchbarkeit ist bei hohen Aschengehalten gegeben. Da die Rauchbarkeit sehr
stark mit der Farbe korreliert (siehe oben), dürfte es hier vor allem auf den
Zusammenhang mit der Eisen-Gerbstoff-Reaktion, die für die Dunkelfärbung des
Eichenholzes verantwortlich ist, zurückzuführen sein.
Elementgehalt
Bestimmung der Elemente im
Probenmaterial (Elementaranalyse):
Vor der Bestimmung wurde das Material für
48 Stunden bei 40°C und 80 mbar im Vakuumtrockenschrank getrocknet. Zur Analyse
wurden jeweils 500-700 mg der getrockneten Proben verwendet.
Die Proben
wurden in verschließbare, hochdruckgeeignete Teflongefäße eingewogen und mit 0,5
ml 30%igem H2O2 (Wasserstoffperoxidlösung), 1ml 70%iger HClO4 (Perchlorsäure)
und 6ml conc. HNO3 (Salpetersäure) versetzt. Der Hochdruck-Mikrowellen
Aufschluss wurde in eine Labormikrowelle (MLS 1200) durchgeführt. Dazu wurde ein
Programm mit unterschiedlichen Heiz- und Kühlphasen verwendet: 2 min 250 Watt, 1
min Kühlen, 2 min 250 Watt, 1 min Kühlen, 8 min 250 Watt, 1min Kühlen, 4 min 650
Watt, 1 min Kühlen 5 min 350Watt, 10 min Kühlen.
Nach einer Aufschlussdauer
von 35 Minuten wurden die Gefäße abgekühlt, die Aufschlusslösung filtriert, und
mit bi-destilliertem Wasser auf 50ml aufgefüllt. Die qualitative und
quantitative Bestimmung der Metalle wurde unter Verwendung von Metall-Standards
mittels Flammen AAS (Atom Absorption Spektroskopie) und ICP-OES (Inductive
Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy) durchgeführt.
Es wurden folgende Elemente
bestimmt:
Natrium, Kalium, Eisen, Kalzium, Magnesium, Zink, Kupfer, Chrom,
Mangan, Nickel und Aluminium
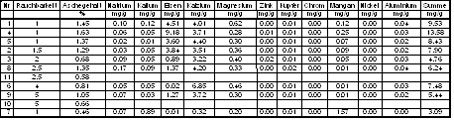
Tabelle 4: Element- und Aschengehaltsanalyse der Proben
(gereiht nach der Rauchbarkeit)
In Tabelle 4 ist zu sehen, dass die
Elemente Natrium, Kalium, Zink Kupfer, Chrom, Mangan, Nickel und Aluminium kaum
vertreten sind. Vor allem Eisen, Kalzium und Magnesium zeigen höhere Werte.
Fengel und Wegener (1989) beschreiben die Elemente Kalzium und Magnesium, als
die häufigsten Element im Holz. Diese Elemente sind wichtig beim Aufbau der
Holzmasse.
D.h. vor allem der Eisen-Wert ist für die Mooreiche interessant.
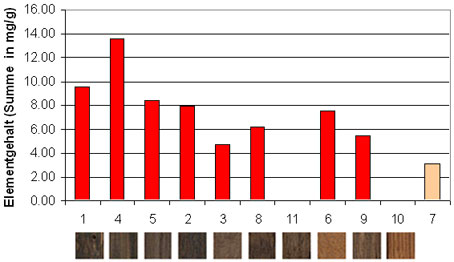
Abbildung 11: Elementgehalt (Summe) der Proben (gereiht nach
abnehmender Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)
Die Summe der gemessenen Elemente zeigen
einen interessanten Zusammenhang mit der Rauchbarkeit (siehe Abb. 11): Gute
Rauchbarkeit ist beim Vorhandensein hoher Elementgehalte gegeben. Da diese
Reihung sehr gut mit den durch eine andere Methode bestimmten Aschengehalten
korreliert kann angenommen werden, dass keine wichtigen Elemente vernachlässigt
wurden. In manchen Proben könnten noch in sehr geringen Mengen Silikate
eingelagert gewesen sein die aber durch die gewählte Aufschlussmethode nicht
erfasst werden konnten. Die im Vergleich zum Aschegehalt niedrigere Summe des
Elementgehaltes kann durch die nichtbestimmten Anion erklärt werden. Bei der
Aschegehaltbestimmung liegen die meisten Metalle als Oxide vor, was natürlich
nicht ihrem Status im nativen Holz entspricht wo auch andere Gegen-Ionen
gefunden werden können.
Da vor allem die Elemente Eisen, Kalzium
und Magnesium zur Gesamtsumme beitragen (siehe Tab. 4), jedoch die Elemente
Kalzium und Magnesium generell im Holz enthalten sind (durch den Holzaufbau),
wird vor allem der Eisengehalt getrennt dargestellt (Abb. 12).
Wie schon erwähnt, ist vor allem die
Eisen-Gerbstoff-Reaktion für die Dunkelfärbung des Eichenholzes verantwortlich.
Dies wird von Fengel und Wegener (1989) auch für frisches Eichenholz
beschrieben.
D.h. in erster Linie wird die Farbe (in
Richtung dunkelgrau bis schwarz) durch die Eisenkonzentration der Umgebung, in
der die Eichenstämme lagerten (über Jahrhunderte bis Jahrtausende), beeinflusst.
Diese dunkle Farbe kann dann durch Abbauprozesse des Holzes durch – vor allem –
Bakterien wieder modifiziert werden. Diese zwei Prozesse zu trennen oder zu
quantifizieren ist – nach heutigem Wissensstand – nicht möglich.
Die Abbildungen 12 und 13 zeigen den
relativ deutlichen Zusammenhang zwischen dem Eisengehalt und der Rauchbarkeit.
Die dunklen Hölzer weisen mehr Eisen auf und sind besser zu rauchen. D.h. es ist
hier eine Bestätigung der Farbgebung durch die Eisen-Gerbstoff-Reaktion zu
sehen.
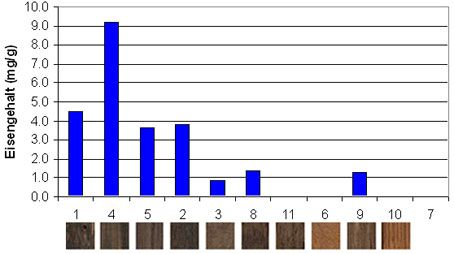
Abbildung 12: Elementgehalt (Eisen) der Proben (gereiht nach
abnehmender Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)
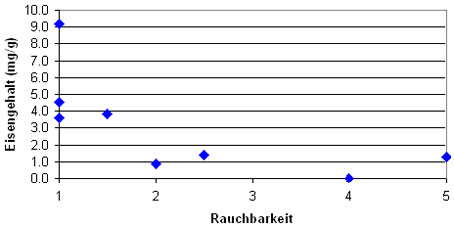
Abbildung 13: Die Abhängigkeit der Rauchbarkeit vom
Eisengehalt (ohne Probe 7).
Zusammenfassung und
Schlußfolgerungen
Holz wird in ausreichend feuchtem Milieu über
Jahrtausende konserviert. Diese Umstände liegen einerseits in Flussschottern,
als auch in Mooren vor. Dies sind auch die zwei möglichen Fundorte für
Mooreichen-Holz. Unter weitestgehendem Luftabschluss kommt es nur zu einem sehr
langsamen bakteriologischen Abbau des Holzes (Rowell und Barbour 1990). Ist der
Luftabschluss allerdings nicht immer ausreichend gewährleistet, kann es auch zum
Abbau des Holzes durch Pilze bzw. Moderfäule kommen. Schon vor der Einschüttung
des Baumes, kann dieser durch Pilze angegriffen worden, und somit das Holz
beeinträchtigt worden sein.
D.h. das erhältliche Mooreichen-Holz
kann in seiner „Qualität“ sehr stark variieren. Dieses Projekt wurde
durchgeführt um eine Abschätzung der Brauchbarkeit des Holzes für den Pfeifenbau
im Vorhinein machen zu können.
Das Alter des Holzes ist stark variabel.
Die Radiokohlenstoffuntersuchungen brachten Ergebnisse zwischen 1300 und 5000
Jahren. Dieser enorme Altersunterschied ist den Hölzern nicht „anzusehen“. D.h.
man kann auf Grund der Farbe etc. nicht das Alter des Holzes abschätzen.
Als wesentlichster Einflussfaktor für
die Rauchbarkeit zeichnet sich der Abbaugrad - und damit eng in Verbindung
stehend – die chemischen Eigenschaften des Holzes ab.
Dies wurde
durch mehrere Parameter bestätigt:
-
Die
Holzfarbe zeigt schon einen relativ guten Zusammenhang mit der Rauchbarkeit. Die
dunklen Hölzer (dunkelgrau bis schwarz) sind besser geeignet. Die dunkle Farbe
ist auf die Eisen-Gerbstoff-Reaktion, die vor allem für Eichenholz beschrieben
wird, zurückzuführen.
-
Die
Holzdichte ist für gute Rauchbarkeit hoch. Der höchste gemessene Wert liegt bei
880kg/m³; und somit höher als in der Literatur angegeben (615 - 760 kg/m³). Die
Rohdichtewerte von frischem Eichenholz variieren zwischen 430 und 960 kg/m³
(Wagenführ und Scheiber 1985). Die mögliche hohe Ausgangsdichte (vor der
Einschüttung) erklärt die hohen Werte der Mooreiche.
-
Auch die Parameter Quellung und
Feuchtigkeitsaufnahme hängen stark mit dem „Zustand“ des Holzes zusammen und
können vor allem durch Modifikation der organisch-chemischen Zusammensetzung des
Holzes beeinflusst werden. Jedenfalls weisen gut brauchbare Hölzer eine höhere
Quellung und vermindertes Wasseraufnahmepotential auf. Die höchsten Werte der
tangentialen Quellung entsprechen ungefähr den für frisches Eichenholz zu
erwartenden Quellungswerten.
-
Der
Aschegehalt des Mooreichen-Holzes hängt relativ stark mit der Rauchbarkeit
zusammen: Gute Rauchbarkeit ist bei hohem Aschegehalt gegeben
-
Der
Elementgehalt – vor allem der Anteil an Eisen – ist bei Hölzern mit guter
Rauchbarkeit hoch. Nachdem diese Hölzer auch eine dunkle Farbe besitzen, dürfte
dieser Umstand auch auf die Eisen-Gerbstoff-Reaktion zurückzuführen sein.
Kurz zusammengefasst kann man sagen,
dass hochdichte, dunkle Mooreichen-Hölzer gut zu rauchen sind.
Zitierte Literatur:
Fengel, D., Wegener, G. 1989: Wood.
Chemistry, Ultrastructure, Reactions. Walter de Gruyter, Berlin.
Rowell, R.M., Barbour, R.J. 1990:
Archaeological Wood. Properties, Chemistry and Preservation. Advances in
Chemistry Series: 225, American Chemical Society, Washington D.C.
Wagenführ, R. Scheiber, C. 1985:
Holzatlas. VEB Fachbuchverlag Leipzig.

Wien im Dezember 2008
© copyrigth 2009 - Prammer Josef –
Ungenach
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2009 by TECON GmbH
mit
freundlicher Unterstützung von Josef Prammer